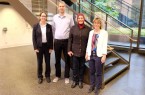Medizin & Gesundheit
Kleiner Schnitt, große Wirkung
Klinikum Gütersloh Vorreiter in der Region bei minimalinvasiver Hüftchirurgie nach der AMIS-Methode Gütersloh. Der künstliche Gelenkersatz des Hüftgelenkes ist der häufigste orthopädisch-chirurgische Eingriff weltweit. Auch in Deutschland werden pro Jahr mehr als 200.000 Hüftgelenke durch Prothesen ersetzt. Doch wer eine neue Hüfte bekommen hat, braucht oft Wochen und Monate, um wieder auf die Beine zu […]
Pankreaskrebs Zentrum Gütersloh
Erfolgreiche Zertifizierung des Pankreaskrebs Zentrums am Klinikum Gütersloh Gütersloh (kgp). Bauchspeicheldrüsenkrebs – das sogenannte Pankreaskarzinom – gehört mit deutschlandweit etwa 17.000 Neuerkrankungen pro Jahr zwar nicht zu den häufigsten Krebsarten, wohl aber zu denen, die besonders bösartig und aggressiv sind. Im Pankreaskrebs Zentrum des Klinikum Gütersloh arbeiten Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete eng zusammen, um die bestmögliche […]
Blick ins Innere
Modernisierung der Endoskopieabteilung im Klinikum Gütersloh abgeschlossen Gütersloh. Mehr Platz, Komfort und Patientensicherheit, höchste Hygienestandards sowie fortschrittliche Medizintechnik bei endoskopischen Untersuchungen: Nach mehrmonatigen Modernisierungsarbeiten hat das Klinikum Gütersloh nun alle neuen Räumlichkeiten der Endoskopieabteilung in Betrieb genommen. Für die jährlich rund 5.000 Patienten ist auf über 500 Quadratmetern ein freundlicher, lichtdurchfluteter Diagnose- und Behandlungsbereich mit […]
Ärzte und Patienten im Dialog
15. Corveyer Gesundheitsgespräche starten am 10. Oktober Kreis Höxter. Chefärzte aus dem Klinikum Weser-Egge referieren in den kommenden Monaten im Weltkulturerbe Schloss Corvey. Dr. Eckhard Sorges und Dr. Ekkehart Thießen, Chefärzte der Medizinischen Klinik I und II am Standort St. Ansgar Krankenhaus in Höxter, setzen auf das bewährte Konzept der seit 15 Jahren bestehenden Veranstaltungsreihe: […]
Entzündungen der Venen im Fokus
Marienmünster. Mediziner aus der Region trafen sich kürzlich auf Einladung von Dr. Detlef Michael Ringbeck, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am St. Josef Hospital Bad Driburg, zum Erfahrungsaustausch in der Abtei zu Marienmünster. Als Gastreferent konnte Organisator Ringbeck seinen Kollegen Dr. Christian Stelzner, Oberarzt der II. Medizinischen Klinik des Städtischen Klinikums Dresden, gewinnen. Stelzner ist […]
Engagiert im grünen Kittel
Die „Grüne Damen“ im Klinikum Gütersloh unterstützten Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes Gütersloh. „Wir haben Zeit. Wir setzen uns ein. Wir reichen dem Kranken unsere Hand.“ Nach diesem Motto sind im Klinikum Gütersloh derzeit 19 so genannte „Grüne Damen“ aktiv. Sie stehen den Patienten mit Gesprächen oder kleinen Besorgungen zur Seite und sind inzwischen ein unverzichtbarer […]
Gut aufgehoben bei Leisten-, Narben- und Zwerchfellbrüchen
Klinikum Gütersloh erhält Qualitätssiegel für die Hernienchirurgie Gütersloh. Bauchwandbrüche, so genannte Hernien, gehören in Deutschland zu den häufigsten Erkrankungen, die chirurgisch behandelt werden müssen: Bundesweit werden jedes Jahr etwa 350.000 solcher Hernienoperationen durchgeführt. Der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und minimalinvasive Chirurgie des Klinikum Gütersloh wurde die gute Betreuung und Nachversorgung dieser Patienten nun mit dem […]
Top-Bewertung für die Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh
Gütersloh. Spitzenposition für die Geburtshilfe im Klinikum Gütersloh: Das Krankenhaus erreicht in der „Weissen Liste“ der Bertelsmann Stiftung und im Krankenhausnavigator der AOK und der Barmer eine Weiterempfehlungsquote von 93% und liegt damit in Ostwestfalen-Lippe auf dem ersten Rang. In NRW konnte das Klinikum mit diesem Wert Platz 3, deutschlandweit Platz 21 von 719 Krankenhäusern […]
Medizin in der Abtei: Gesundheitsgespräche Marienmünster
Ärzte-Fortbildung: Das kranke Bein Bad Driburg/Marienmünster. Zum bereits achten Mal lädt der Kardiologe und Intensivmediziner Dr. Detlef Michael Ringbeck, Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Klinikum Weser-Egge, St. Josef Hospital Bad Driburg, Allgemein- und Fachärzte zu einer Herbstfortbildung in die Abtei nach Marienmünster ein. Diesmal tauschen sich die Mediziner unter dem Titel „Das kranke Bein“ […]
Sport im Park – Ein voller Erfolg mit 580 Teilnehmern
Gütersloh. Menschen für Sport und Bewegung zu begeistern – das war erneut das Ziel der 4. Auflage von „Sport im Park“. Und das ist gelungen: 580 Teilnehmer haben den zum Teil heißen Temperaturen getrotzt und sind zu den neun abwechslungsreichen und kostenlosen Bewegungsterminen in den Mohns Park gekommen, um sich an der frischen Luft gemeinsam zu […]
Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle steigt
„Vorbestehende Erkrankungen können sich verschlimmern und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle steigt“ Paderborn. Deutschland ächzt unter einer lange nicht dagewesenen Hitzewelle. Neurologe Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger vom Sportmedizinischen Institut der Universität Paderborn erklärt im Interview, welche gesundheitlichen Auswirkungen die hohen Temperaturen haben können, welche Symptome dann auftreten und gibt allgemeine Verhaltens- und Ernährungstipps […]
Auf hohem Niveau gegen krankhafte Fettleibigkeit
Erfolgreiche Zertifizierung zum Adipositas-Kompetenzzentrum Bad Driburg. Seit wenigen Wochen ist die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirugie des St. Josef Hospital Bad Driburg zertifiziertes Kompetenz zentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie. Die Zertifizierung wurde von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) und der zur DGAV gehörenden Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Adipositastherapie und metabolische Chirurgie (CAADIP) […]
Gesundheit von Herz, Muskeln und Knochen auf dem Prüfstand
1. Mannschaft von Arminia Bielefeld zur sportmedizinischen Untersuchung im Klinikum Gütersloh Gütersloh. Anfangs tritt er noch locker in die Pedale, dann wird der Widerstand stetig stärker: Andreas Voglsammer kommt auf dem Fahrradergometer mächtig ins Schwitzen. Wie seine anderen Mannschaftskameraden vom Zeitliga-Verein DSC Arminia Bielefeld wurde auch der Stürmer bei der Untersuchung im Sportmedizinischen Zentrum des […]
Volkskrankheiten Adipositas und Herzrhythmusstörungen im Fokus
Veranstaltungsreihe „Medizin in der Mitte“ im Bad Driburger Rathaus: Bürger fragen – Ärzte antworten Bad Driburg. Zum dritten Mal stellten Fachärzte im Bad Driburger Rathaus mit patientennahen Vorträgen das Leistungsspektrum des St. Josef Hospitals, das zum Klinikum Weser-Egge gehört, vor. Unter dem Motto „Medizin in der Mitte“ referierten Chefarzt Dr. Florian Dietl über die Adipositas-Chirurgie […]
Die Gesundheitskompetenz fördern
Zwei Forschungsprojekte „FörGES“ sind an der FH Bielefeld gestartet. Bielefeld. Kinder von suchtkranken Eltern unterstützen und Menschen mit geistiger Behinderung fördern – darum geht es in zwei Projekten aus dem Verbund für Förderung der Gesundheitskompetenz (FörGES), die vor kurzem an der Fachhochschule (FH) Bielefeld gestartet sind. Die Forschungskooperation des Instituts für Bildungs- und Versorgungsforschung im […]
1.550 Euro für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe
Gütersloh. Beste Bedingungen und ringsum gute Laune bescherten dem Laufevent „Gütersloh läuft“ Rekord-Teilnehmerzahlen. Die Schlaganfall-Hilfe freute sich über 1.550 gelaufene Kilometer von Bertelsmann Mitarbeitern – für die Bertelsmann jeweils einen Euro spendet. Die nun schon zwölfte Auflage des Laufevents „Gütersloh läuft“ im Gütersloher Stadtpark am vergangenen Sonntag – wieder unter dem Motto „Laufen, lächeln und […]
Dustin Brown und Andre Begemann besuchen die jungen Patienten in Bethel
HalleWestfalen. Sie stellten sich für viele gemeinsame Erinnerungsfotos auf, schrieben fleißig Autogramme: Dustin Brown und Andre Begemannn machten am Montagmorgen als eingespieltes Doppel den jungen Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel eine große Freude. „Es ist immer wieder schön, hier bei den Kindern zu Besuch zu sein“, sagte Brown, […]
Firmen setzten sich für Gesundheit ein
Büren. Die Bürener Firmen „m&s Sprossenelemente GmbH“ und „FTF Sander GmbH“ führen regelmäßig Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeiter durch. Mit Unterstützung der AOK Paderborn wurden nunmehr Rückenmessungen geplant, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hinweise für ihre persönlichen, präventiven Verhaltensmöglichkeiten erhielten. Das Team des ARC-Gesundheitsmobils führte diese sehr speziellen Messungen […]
Timo Siebert neuer Kaufmännischer Direktor
Gütersloh/Paderborn. Die Kliniken des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Gütersloh und Paderborn haben bald einen neuen gemeinsamen Kaufmännischen Direktor. Timo Siebert (39) aus Ascheberg wird zum 1. November 2018 Nachfolger des langjährigen Kaufmännischen Direktors Reinhard Loer, der dann in den Ruhstand gehen wird. Timo Siebert stammt gebürtig aus Kassel, wohnt mit seiner Familie in Ascheberg, er […]
Reiseimpfungen – guter Schutz, entspannter Urlaub
Auf empfohlene Impfungen im Urlaubsland achten Bielefeld. Sommerzeit – Reisezeit. Wer in fernen Ländern Urlaub macht, erlebt nicht nur andere Menschen, fremde Kulturen und exotische Speisen, sondern ist auch anderen, fremden Krankheitserregern ausgesetzt. Diese Infektionserreger sind überwiegend in warmen Ländern verbreitet und können schwere, manchmal lebensbedrohliche Krankheiten hervorrufen. Damit Urlauber gut geschützt in die Ferne […]
Arne Dallmann blickt ins Körperinnere
Kreis Höxter. Arne Dallmann, Chefarzt des Instituts für Radiologie des Klinikum Weser-Egge, steht künftig für die ambulante Versorgung von Patienten vermehrt auch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Weser-Egge Höxter zur Verfügung. Der Facharzt für Diagnostische Radiologie ist Spezialist für die Interpretation von Bildern aus dem Körperinneren des Patienten. Wer Schmerzen oder diffuse Beschwerden hat, wird in der […]
Schilddrüsentag mit Informationen von Experten
Bad Driburg. Die Schilddrüse reguliert den Stoffwechsel, den Energieverbrauch, die Wärmeproduktion und sie ist mitverantwortlich für die Darmtätigkeit. Wenn die Hormonzentrale des Körpers nicht mehr richtig funktioniert, hat das Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Beim 12. Tag der Schilddrüse informierten sich rund 100 Besucher über Veränderungen und Erkrankungen des Organs, das Referent Dr. Stefan Micus, niedergelassener […]