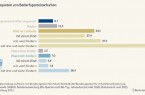Tag Archives: Arbeit
Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ endet am 31. August
Radler in Bielefeld können jetzt noch beim Rad-Wettbewerb mitfahren Bielefeld. Radfahren ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ‚in‘. Viele Menschen auch aus Bielefeld haben sich in diesem Jahr wieder an der Gemeinschaftsaktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von AOK NordWest und dem Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) beteiligt und sind seit dem 1. Mai regelmäßig mit dem […]
Bildung und Arbeit rücken beim Thema Integration verstärkt in den Fokus
Stadt Gütersloh schreibt ihr Integrationskonzept fort – Mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschen sich in der Stadthalle zu neuen Zielen aus. Gütersloh. Das vor vier Jahren vom Gütersloher Statdtrat beschlossene Integrationskonzept bedarf einer Anpassung. In einigen Handlungsfeldern erfordert die Entwicklung, die der Bereich Zuwanderung zuletzt genommen hat, aktualisierte Ziele. Mit diesem Zwischenergebnis ist jetzt […]
Experten und Wirtschaftsakteure wollen den Wandel der Arbeit in OWL aktiv gestalten
Die Regionalagentur begrüßte zu ihrer Online-Veranstaltung „Arbeit im Wandel – Veränderung gestalten, Chancen nutzen“ über 100 Gäste, darunter Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteure, Unternehmen und Weiterbildungseinrichtungen. Bielefeld. Am 25. August 2021 konnten sich die Teilnehmenden in drei Foren über regionale Initiativen, Projekte und Förderangebote rund um die Themen „Arbeitswelt im digitalen Wandel“, „Lernen in der Zukunft“ und „Nachhaltige […]
Trotz Arbeit abgehängt: Armutsrisiko von Alleinerziehenden verharrt auf hohem Niveau
Gütersloh. Der Anteil der alleinerziehenden Familien, die von Einkommensarmut gefährdet sind, bleibt hoch. Obwohl sie häufig einer Erwerbstätigkeit nachgehen, können viele Alleinerziehende keine gesicherte Existenz für sich selbst und ihre Kinder schaffen. Weitere Reformen sind notwendig – auch, um die Corona-Belastungen zu mildern. Das Risiko, in Armut zu leben, ist für alleinerziehende Familien in Deutschland […]
Mit gutem Beispiel mit- und vorangehen Agenturen für Arbeit in OWL leben Inklusion am Arbeitsplatz
Bielefeld. Am 03. Dezember war der Tag der Menschen mit Behinderung. Weltweit gibt es circa eine Milliarde Menschen, die eine Behinderung haben. In Deutschland sind es 7,8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung, also knapp jeder zehnte Einwohner. Inklusion ist auch deshalb ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil es so viele betrifft. Ein Thema, dem sich auch Deutschlands größte […]
34.000 Beschäftigte in Ostwestfalen-Lippe
Hochproduktion durch Corona | „Arbeitszeitvorschriften nicht aushebeln“ – Lebensmittelindustrie arbeitet am Limit: Bielefeld. Sie sorgen für Nachschub im Supermarkt: Die rund 34.000 Menschen, die in derostwestfälischen Lebensmittelindustrie arbeiten, leisten in der Coronavirus – Pandemie einen entscheidenden Beitrag dafür, dass Essen und Trinken nicht knapp werden. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss – Gaststätten (NGG) hingewiesen. „Überstunden und […]
Durchstarten in Ausbildung und Arbeit
Kreis Gütersloh. Mit der Umsetzung der Landesinitiative ‚Durchstarten in Ausbildung und Arbeit‘ möchte der Kreis Gütersloh junge geflüchtete Menschen im Sinne einer nachhaltigen Integration fördern. Dies soll dazu beitragen, dass sie durch die Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeitstätigkeit ihren Lebensunterhalt selbständig bestreiten können. Im Kreishaus Gütersloh fand jetzt die Auftaktveranstaltung zur Umsetzung der Landesinitiative statt. […]
Streetworkerin hat Arbeit in Horn-Bad Meinberg aufgenommen
Nach kurzer Zeit bereits handfeste Ergebnisse: Streetworkerin Esra Gleim hat in Horn Kontakt zu fast jeder bulgarischen Familie aufgenommen und vermittelt zwischen allen Beteiligten. „Frau Gleim hat erste Brückenpersonen als Mittler gewonnen. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass wir dank des Engagements von Frau Gleim starke Impulse für eine positive Entwicklung der Situation in Horn […]
Arbeiten im Risikobereich: „Kindesschutz braucht eine offene und konstruktive Fehlerkultur“
Paderborn. Kreisjugendhilfeausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Kindesschutz. Christine Gerber vom Deutschen Jugendinstitut München ist überzeugt, dass die Analyse von problematischen Fallverläufen im Kindesschutz einen wertvollen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in Jugendämtern leisten kann. Weil sie helfen, riskante Denk- und Handlungsmuster sowie fehlerbegünstigende institutionelle Rahmenbedingungen zu erkennen und zu verändern. Einfach formuliert: Entscheidend ist, wie Menschen […]
Azubis zeigen Schülern ihre Arbeitswelt
Kreis Höxter. Die Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf ist für Schülerinnen und Schüler oft mit vielen Fragezeichen verbunden: Welcher Job ist der Richtige? Welche Anforderungen werden gestellt? Wie läuft eine Ausbildung ab? Antworten erhalten sie in dem neuen Programm „backstage.AUSBILDUNG“ direkt von erfahrenen Auszubildenden. Organisiert wird es von der Kommunalen Koordinierungsstelle für den Übergang Schule […]
Neue Arbeitsplätze für den Sozialen Arbeitsmarkt
euwatec bekommt eine Förderung aus dem Innovationsfonds Kreis Lippe. Mit dem Innovationsfonds sollen zusätzliche Arbeitsplätze für den Sozialen Arbeitsmarkt geschaffen werden. 300.000 Euro pro Jahr stellen der Kreis Lippe und das Netzwerk Lippe, die kommunale Beschäftigungsförderungsgesellschaft, für Projekte zur Verfügung, die auf Grundlage des Teilhabechancengesetzes geplant sind. Nun hat mit der Firma euwatec gGmbH ein […]
Azubis oder Praktikanten für MINT-Jobs gesucht
Kreis Lippe. Es ist ein kleines Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal veranstaltet das zdi-Zentrum Lippe.MINT am Dienstag, 8. Oktober, von 8 bis 13 Uhr einen Tag „Naturwissenschaften und Technik in Beruf und Studium erleben“ in der Phoenix Contact Arena in Lemgo. Interessierte Akteure sind auch in diesem Jahr dazu eingeladen, sich mit Workshops, Führungen und […]
Agentur für Arbeit Bielefeld: Arbeitsmarktbericht vom August 2019
Bielefeld. Es ist ein Anstieg der Arbeitslosenquote im zweiten Ferienmonat (August 2019 ) ermittelt worden. Der Arbeitsmarkt im August 2019 (Stadtgebiet Bielefeld): Hier zur Übersicht die Zahlen u. Fakten: Im August sind 180 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als im Juli Die Zahl arbeitsloser Personen liegt in diesem Monat bei 13.493 Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet Bielefeld […]
IHK – Zahlenspiegel ,,Daten und Fakten 2019’’ erschienen
Neue Informationen über den Wirtschaftsraum Ostwestfalen liefert der druckfrische Zahlenspiegel ,,Daten und Fakten 2019″ der Industrie – und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK). Bielefeld. Das zwölfseitige Faltblatt informiert in kurzer und übersichtlicher Form über die wesentlichen Zahlen der gewerblichen Wirtschaft Ostwestfalens. Es zeigt wirtschaftliche Trends im Vergleich zu Bund und Land auf und benennt Arbeitsbereiche und […]
Recht auf Homeoffice
Nur 1,5 Prozent aller Stellenangebote in Deutschland bieten diese Möglichkeit an. Adzuna analysiert rund 481.000 Stelleninserate in Deutschland auf ihr Homeoffice-Angebot. 1,5 Prozent aller Stellenausschreibungen bieten Heimarbeit an. Große Unterschiede zwischen den Bundesländern und 20 größten Städten Frankfurt am Main, – Die Grünen fordern aufgrund steigender Temperaturen ein “Recht auf Homeoffice” für deutsche Arbeitnehmer. In Deutschland bieten Arbeitgeber dies […]
Mitmach-Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ gestartet:
Bielefeld. Bei schönem Wetter macht es besonders Spaß: Das Fahrrad aus dem Keller oder der Garage holen und los geht es. Viele Menschen aus Bielefeld freuen sich auf die gemeinsame Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von der AOK und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Vom 1. Mai bis zum 31. August gilt es an mindestens 20 […]
Jahreshauptversammlung der AGBI
Bielefeld. Die Arbeitsgemeinschaft Bielefelder Beschäftigungsinitiativen AGBI e.V. ist seit 35 Jahren ein lokaler Dachverband von aktuell 17 Bielefelder Gesellschaften und Vereinen, die Angebote für Langzeitarbeitslose und für Jugendliche ohne Ausbildung organisieren. Den geschäftsführenden Vorstand bilden Bruno Hartmann (Profil Grünbau), Dr. Markus Schäfer (Verein BAJ) und Anke Schmidt (Kurz Um-Meisterbetriebe) sowie als Beisitzer Peter Struck […]
Neue DGB-Studie
Dringender Handlungsbedarf bei Arbeitszeiten Bielefeld. Eine aktuelle Studie des DGB NRW zeigt, dass die Arbeitszeiten in den Betrieben aus dem Ruder laufen. „Die Bedürfnisse der Beschäftigten sind in den letzten Jahren aus dem Blick geraten und die Arbeit hochgradig flexibel nach den Bedürfnissen der Unternehmen aus gerichtet. Das muss sich ändern. Der Mensch muss wieder […]
IHK: Ausbildungsangebot steigt, Interesse zu gering
Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat Anfang April insgesamt acht Prozent mehr Ausbildungsverträge eingetragen als zum Vorjahreszeitpunkt (absolut 2.961; 2014 = 2.741). Dabei fällt der Anstieg in den gewerblich-technischen Berufen mit 15,1 Prozent noch deutlich stärker aus als in den kaufmännischen (+ 3,7 Prozent). „Wir verstehen das Ergebnis als Zwischenstand, da […]