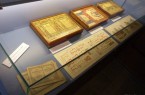Tag Archives: Objekt im Fokus
Objekt im Fokus in den Monaten Januar & Februar
Minden. Wie bereits mit den Kabinettausstellungen begonnen, möchte das Museumsteam die Vielfalt, die Geschichte und den Dokumentationsstand seiner Sammlung vorstellen. Im Rahmen des Projekts „Objekt im Fokus“ soll daher alle zwei Monate ein Objekt der Sammlung frei zugänglich im Foyer des Museums ausgestellt und seine Geschichte erzählt werden. Das Objekt im Fokus in den Monaten […]
Objekt im Fokus: Mindener Nachtwächterplakette, 1820-1870
In der Sammlung des Mindener Museums werden rund 60.000 Objekte bewahrt. Trotz Dauer- und Sonderausstellungen oder Leihgaben an andere Museen lagern 95% der Sammlung verborgen im Magazin. Die Vielfalt und die Geschichte der Sammlung und das Wissen über die Objekte stellt das Museumsteam regelmäßig in Kabinettausstellungen vor. Alle zwei Monate wird außerdem ein „Objekt im […]
Objekt im Fokus „Zwei Holzvögel“
In der Sammlung des Mindener Museums werden rund 60.000 Objekte bewahrt. Trotz Dauer- und Sonderausstellungen oder Leihgaben an andere Museen lagern 95% der Sammlung verborgen im Magazin. Die Vielfalt und die Geschichte der Sammlung und das Wissen über die Objekte stellt das Museumsteam regelmäßig in Kabinettausstellungen vor. Alle zwei Monate wird außerdem ein „Objekt im […]
Objekt im Fokus „Pferde-Moorholzschuh, um 1850“
In der Sammlung des Mindener Museums werden rund 60.000 Objekte bewahrt. Trotz Dauer- und Sonderausstellungen oder Leihgaben an andere Museen lagern 95% der Sammlung verborgen im Magazin. Die Vielfalt und die Geschichte der Sammlung und das Wissen über die Objekte stellt das Museumsteam regelmäßig in Kabinettausstellungen vor. Alle zwei Monate wird außerdem ein „Objekt im […]
Objekt im Fokus
„Spielzeugfuhrwagen, Heinrich Bredemeier, Minden i. W.“ Minden. In der Sammlung des Mindener Museums werden rund 60.000 Objekte bewahrt. Trotz Dauer- und Sonderausstellungen oder Leihgaben an andere Museen lagern 95% der Sammlung verborgen im Magazin. Die Vielfalt und die Geschichte der Sammlung und das Wissen über die Objekte stellt das Museumsteam regelmäßig in Kabinettausstellungen vor. Alle […]
Objekt im Fokus in den Monaten März und April
Minden. Wie bereits mit den Kabinettausstellungen begonnen, möchte das Museumsteam die Vielfalt, die Geschichte und den Dokumentationsstand seiner Sammlung vorstellen. Im Rahmen des Projekts „Objekt im Fokus“ soll daher alle zwei Monate ein Objekt der Sammlung frei zugänglich im Foyer des Museums ausgestellt und seine Geschichte erzählt werden. Das Objekt im Fokus im März und […]
Mindener Museum: Objekte im Fokus im Januar & Februar
Objekt im Fokus: „Gefäße und Scherben aus den Brandschüttungs- und Brandgrubengräbern in Minden-Hahlen“ Minden. In der Sammlung des Mindener Museums werden rund 60.000 Objekte bewahrt. Trotz Dauer- und Sonderausstellungen oder Leihgaben an andere Museen lagern 95% der Sammlung verborgen im Magazin. Die Vielfalt und die Geschichte der Sammlung und das Wissen über die Objekte stellt […]